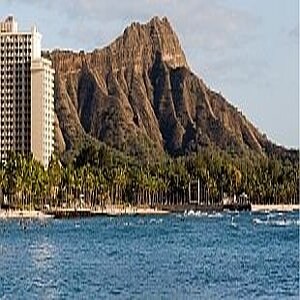Wüstenbildung bekämpfen, Ackerland schützen

IKI Projekt unterstützt Landwirte in Burkina Faso und Senegal bei der Anpassung an den Klimawandel.
Im Senegal und in Burkina Faso bereiten Bodenversalzung, Wüstenbildung, Dürren und Überschwemmungen große Probleme für die Landwirtschaft. Geringer Niederschlag und der steigende Meeresspiegel tragen dazu bei, dass Landwirte produktives Ackerland verlieren. Lokale Gemeinden in beiden Ländern spüren die Auswirkungen am gravierendsten, da sie stark von der eigenen Lebensmittelproduktion abhängig sind.
Das Projekt Ökosysteme - Schutz für Infrastruktur und Gemeinschaften (Ecosystems - Protection for Infrastructure and Communities, kurz EPIC) unterstützt lokale Gemeinden aus zwölf Dörfern im Westen Senegals und im Norden Burkina Fasos dabei, ihre Anbauflächen mit Hilfe traditioneller Praktiken nachhaltig in Stand zu setzen.
Das Vorhaben wird in Burkina Faso und im Senegal von International Union for Conservation of Nature (IUCN) durchgeführt und vom Bundesumweltministerium über die Internationale Klimaschutzinitiative (IKI) mit rund vier Millionen Euro gefördert.
Im April 2016 reisten sechs Vertreter der Dörfer aus dem Norden Burkina Fasos nach Foundiougne im Westen Senegals, um sich mit den senegalesischen Teilnehmern des Projekts auszutauschen. Während des Austausches diskutierten die Landwirte und Viehzüchter gemeinsam über Probleme und Lösungsmöglichkeiten. Ein Beispiel für eine Lösung ist eine sogenannte „Faschine“ – ein Wall aus Reisigstöcken, die entlang einer Böschung in die Erde gesteckt sind. Diese Methode wird im Senegal verwendet, um Eindringen von Salz und Bodenerosion zu reduzieren und die Versickerung von Wasser zu erhöhen.

In Burkina Faso wurden bisher Gabionen, Dämme aus Drähten und Steinen, genutzt, um Wasser und Bodenressourcen zu schonen. Diese Methode ist für die Produzenten jedoch sehr arbeitsintensiv, da die Steine ausgegraben und weitertransportiert werden müssen. Faschinen stellen eine einfachere und weniger zeitaufwändige Alternative für die Landwirte aus Burkina Faso dar und sollen in den Dörfern nun getestet werden.
Ein anderes Beispiel für eine traditionelle Methode ist die „Zaї“-Technik, die zur Bekämpfung der Dürre in Burkina Faso in den 1970ern und 1980ern eingesetzt wurde. Sie wurde durch Yacouba Sawadogo wieder eingeführt und dadurch bekannt gemacht. Sawadogo, ein Ackerbauer aus Burkina Faso, gelang es, einen ganzen Wald in der Wüste zu pflanzen und so den Boden fruchtbar zu machen. Er startete eine Massenbewegung. Heute empfehlen die Vereinten Nationen seine Methode zur Nachahmung. Zaї sind Bodenlöcher, in die organisches Material gegeben wird, auf das Samen von Feldfrüchten, wie Hirse oder Sorghum, folgen. Durch die Löcher sammelt sich Wasser um die Pflanze, das in Dürreperioden als Reservoir dient. Landwirte aus Burkina Faso nutzen diese Methode nun auch zur Aufforstung. Zuvor wurden Keimlinge, die aus dem organischen Material in den Zaї-Stellen wuchsen, von den Landwirten entwurzelt. Jetzt belassen sie diese im Boden, um die Baumbedeckung und die Bodenqualität zu verbessern. Diese Praktiken des Zaї waren den senegalesischen Landwirten bislang unbekannt.
 Die Nachfrage nach Feuerholz und die damit zusammenhängende Entwaldung tragen in Burkina Faso wie im Senegal zur Bodendegradation bei. Als Teil des IKI-Projektes wurden in den Dörfern in Burkina Faso Biogasanlagen installiert, die Kochgas aus Viehdung als Alternative zu Feuerholz produzieren. Zurzeit wird der Dung im Container der Biogasanlage, die in Burkina Faso benutzt wird, noch von den Frauen per Hand gemischt. Eine Handkurbel, so wie sie im Senegal verwendet wird, könnte eine große Veränderung für die Menschen in Burkina Faso bedeuten.
Die Nachfrage nach Feuerholz und die damit zusammenhängende Entwaldung tragen in Burkina Faso wie im Senegal zur Bodendegradation bei. Als Teil des IKI-Projektes wurden in den Dörfern in Burkina Faso Biogasanlagen installiert, die Kochgas aus Viehdung als Alternative zu Feuerholz produzieren. Zurzeit wird der Dung im Container der Biogasanlage, die in Burkina Faso benutzt wird, noch von den Frauen per Hand gemischt. Eine Handkurbel, so wie sie im Senegal verwendet wird, könnte eine große Veränderung für die Menschen in Burkina Faso bedeuten.
„Wir können jetzt sehen, dass diese Techniken an den lokalen Kontext angepasst werden und, dass sie auch das Potential haben, exportiert zu werden und damit auch den Grundgedanken dieses Besuchs widerspiegeln – lokales Wissen zu teilen und zu erkennen, wie es im Senegal oder in Burkina Faso genutzt werden kann“, sagt Camille Buycke, Projektkoordinatorin von IUCN.
Quelle: IUCN
Der Link wurde in die Zwischenablage kopiert
Kontakt
IKI Office
Zukunft – Umwelt – Gesellschaft (ZUG) gGmbH
Stresemannstraße 69-71
10963 Berlin