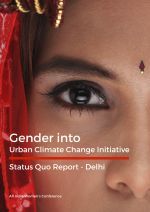Interview: Gender-Konzepte in der Klimapolitik

Ndivile Mokoena, Projektkoordinatorin für GenderCC in Südafrika, spricht über verschiedene Möglichkeiten zur Verankerung von Gender-Konzepten in der Klimapolitik.
Die Verabschiedung des Gender Action Plan zählte zu den großen Erfolgen der UN-Klimakonferenz COP 23 in Bonn. Kurz vor der Ankündigung des Plans haben wir mit Ndivile Mokoena über ihre Arbeit als Projektkoordinatorin für GenderCC gesprochen. Mokoena ist für die Koordination des Projekts Gender into Urban Climate Change Initiative (GUCCI) in Südafrika verantwortlich. Das Projekt befasst sich mit der Bewertung und dem Monitoring der Gender-Komponente in den Klimaschutzstrategien und -programmen von zwei südafrikanischen Städten und wird von der Internationalen Klimaschutzinitiative (IKI) gefördert.
Frau Mokoena, wo standen die Klimaschutzstrategien in Südafrika und wie gut war der Gender-Aspekt darin integriert, als das Projekt begann?
2015 haben wir Johannesburg und Tshwane als Projektstädte gewählt, und zwar vor allem weil beide Städte damals bereits über Strategien und Programme im Zusammenhang mit dem Klimawandel verfügten. Als wir 2016 mit dem GUCCI-Projekt begonnen haben, wurde zunächst ermittelt, wo die beiden Städte in Sachen Klimaschutz stehen. Das Ergebnis war ernüchternd: Obwohl es in Südafrika durchaus Strategien und Programme zum Umgang mit dem Klimawandel gibt, werden diese noch nicht umgesetzt. Und die Gender-Perspektive fehlte völlig, obwohl die Gleichstellung der Geschlechter in der südafrikanischen Verfassung verankert ist. Bisher wurde das Thema von der Regierung und einigen Unternehmen nur berücksichtigt, wenn es um das Geschlechtergleichgewicht, das Empowerment von Frauen und Statistiken ging. Doch es wird nichts unternommen, um den Gender-Aspekt in Strategien, insbesondere im Hinblick auf den Klimawandel, zu verankern. Das Thema Gender ist nur ein Randthema, der Schwerpunkt der Städte liegt dagegen auf den Themen Frauen und Armut.

Wie haben Sie versucht, dies zu ändern?
Zunächst haben wir uns einen Überblick über den Status Quo der Klimastrategien verschafft. Im nächsten Schritt haben wir Interviews mit denjenigen geführt, die in den Projektstädten für die Umsetzung der Klimastrategien verantwortlich sind. Dabei ging es hauptsächlich um Klimaanpassung und Minderungsmaßnahmen sowie um andere Sektoren wie Nachhaltigkeit, Umwelt, Energie und Landwirtschaft. Außerdem haben wir mit Personen gesprochen, die im Gender Forum Desk oder in Abteilungen tätig sind, die sich mit den Belangen von Frauen, Kindern und Menschen mit Behinderungen befassen. Bei der ersten Bewertung haben wir uns auf die institutionellen Verfahren konzentriert und uns angesehen, wie die Planungs-, Konsultations- und Budgetierungsprozesse und ganz konkret die Budgetierung im Bereich Gender ausgestaltet sind. Außerdem haben wir untersucht, wie die zuständigen Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter Konsultationen durchführen und ob die Belange der Menschen vor Ort und die spezifischen Bedürfnisse von Frauen und Männern berücksichtigt werden. Die Verantwortlichen haben durchaus eingeräumt, dass sie bei der Bearbeitung des Themenkomplexes Klimaschutz und Klimaanpassung den Gender-Aspekt nicht als besondere Aufgabe gesehen haben. So wurde in den Berichten und Studien der Projektstädte in Bezug auf Frauen und Kinder in erster Linie auf Vulnerabilitätsstudien abgestellt. Außerdem haben wir festgestellt, dass die Projektstädte selbst in ihren Vulnerabilitätsstudien keine nach Geschlecht oder Gender disaggregierten Daten vorlegen. Die Verantwortlichen haben unsere Kritik positiv aufgenommen, und wir haben einen Bericht geschrieben, in dem wir auf die Lücken hinweisen und geeignete Empfehlungen aussprechen, um diese zu schließen..
Welche Empfehlungen waren das konkret und wie wurden sie aufgenommen?
Wenn Entscheider ihre Strategien entwickeln, müssen sie stärker als bisher Frauengruppen und lokale Gemeinden konsultieren und die dazu geeigneten Strukturen nutzen. Außerdem sollten sie sich von Gender-Experten bei der Verankerung des Gender-Aspekts in ihren Strategien unterstützen lassen, damit diese wirklich gendersensibel sind. Der Prozess läuft noch und wird möglicherweise mehr Zeit beanspruchen, weil in beiden Städten eine neue Regierung angetreten ist, deren Schwerpunkt die Verbesserung der öffentlichen Leistungserbringung ist. Wir müssen jetzt gemeinsam mit den für Klimafragen zuständigen Vertretern überlegen, wie sich Fragen des Klimawandels als Fragen der Leistungserbringung definieren lassen, denn wenn wir die Politiker nicht mit ins Boot holen, werden wir keine Fortschritte erzielen. Es besteht in beiden Städten auch ein großer Bildungs- und Aufklärungsbedarf in Sachen Klimawandel. So müssen die verschiedenen Abteilungen und Sektoren dazu gebracht werden, über den Tellerrand zu blicken, damit Synergien genutzt werden können. Wir haben den Verantwortlichen ans Herz gelegt, Frauen nicht als Opfer, sondern als wichtigen Teil von Lösungen anzusehen Frauen können als Unternehmerinnen, Aktivistinnen, Innovatorinnen und Trägerinnen des Wandels einen wichtigen Beitrag leisten.
Wie entwickeln Sie Ihre Empfehlungen? Spiegelt sich in den Empfehlungen wider, wie andere Länder Gender-Aspekte in ihre Klimapolitik integrieren?
Ja, unsere Empfehlungen wurden durchaus davon beeinflusst, was in anderen Ländern geschieht, denn wir tauschen uns mit Akteuren in aller Welt über Erfahrungen, Herausforderungen und erfolgreiche Lösungen aus und lernen voneinander. Wir haben allerdings versucht, diese externen Erfahrungen an die spezifische Situation vor Ort anzupassen, also an die konkreten Auswirkungen, die der Klimawandel in unserem Land auf Frauen hat, und auf die Sektoren, die dabei eine Rolle spielen. Wir haben beispielhaft gezeigt, was der Staat leisten kann. So haben beide Städte ein Bus-Rapid-Transit-(BRT)-System eingeführt. Dabei ging es jedoch zuerst einmal um die Verbesserung des öffentlichen Personennahverkehrs. Erst später wurde es von den Verantwortlichen auch als ein Beitrag zum Klimaschutz betrachtet.
Wie hängt das Bus-System mit dem Gender-Aspekt zusammen?
Der Gender-Aspekt ergibt sich ganz konkret aus der Festlegung der Busstrecken: Entsprechen die Strecken den Bedürfnissen von Frauen, die zur Arbeit fahren, aber zuvor noch ihr Kind in die Kita bringen müssen? Sind die Bushaltestellen, an der Frauen nach der Arbeit auf den Bus warten müssen, ausreichend beleuchtet und sicher? Oder befinden sie sich etwas abseits, so dass ein Sicherheitsrisiko für Frauen besteht? Sind die Busse innen so ausgestattet, dass den Bedürfnissen von Schwangeren, Menschen mit Behinderungen und kleinen Kindern Rechnung getragen wird? Das sind typische Gender-Aspekte, die bei strategischen Entscheidungen berücksichtigt werden müssen.
Es klingt so, als arbeiten sie hauptsächlich auf politischer Ebene. Sprechen Sie auch mit den Leuten vor Ort?
Unsere Aufgabe besteht darin, dass wir uns für die Verankerung des Gender-Aspekts einsetzen. Dazu sprechen wir nicht nur mit politisch Verantwortlichen, sondern auch mit den Gemeinden. Zurzeit findet viel zu wenig Kommunikation statt, und es gibt kaum Konsultationen zwischen den Gemeinden und der Regierung. Mit unserer Arbeit, unseren Weiterbildungen und Programmen bringen wir alle Beteiligten an einen Tisch. Dadurch haben die Gemeinden die Chance, gegenüber den Regierungsvertretern klar zu benennen, wo genau der Schuh drückt. Wir versuchen, den Bottom-up-Approach zu fördern. Staat und Politik müssen lernen, die Menschen einzubeziehen und ihnen zuzuhören und nicht über ihre Köpfe hinweg zu entscheiden. Sowohl die Gemeinden als auch Politiker und Behördenvertreter wussten unsere Maßnahmen zu schätzen. Sie sind jetzt in der Lage, sich ohne Vorbehalte zusammenzusetzen und offen über Probleme offen sprechen, weil sie einander besser verstehen.
Weshalb ist die Arbeit mit unterschiedlichen Akteuren und den Gemeinden so wichtig?
 Gender CC Südafrika arbeitet schon lange an Gender- und Klimathemen. Doch erst jetzt mit dem GUCCI-Projekt haben wir die Möglichkeit, den direkten Kontakt zu den politisch Verantwortlichen zu suchen, die über Klima- und Gender-Strategien entscheiden. Früher haben wir an öffentlichen Anhörungen der Regierung teilgenommen, wenn es beispielsweise um ein Grünbuch oder den Entwurf für ein Energiegesetz ging, das verabschiedet werden sollte. Bei Klimafragen arbeiten wir hauptsächlich mit den Gemeinden und vor allem mit Frauen, denn bei der Gender-Thematik werden die Belange von Frauen gegenüber denen von Männern nach wie vor nur unzureichend berücksichtigt. Wir arbeiten mit den Frauen vor allem an den Themen Energie, Wasser und Ernährungssicherheit vor dem Hintergrund der Auswirkungen des Klimawandels. Wir verschaffen den Frauen Zugang zu Ressourcen, den richtigen Plattformen und einflussreichen Personen, damit sie sich Gehör verschaffen können, bei öffentlichen Anhörungen wahrgenommen werden und in der Lage sind, ihre eigene, spezielle Situation besser zu gestalten.
Gender CC Südafrika arbeitet schon lange an Gender- und Klimathemen. Doch erst jetzt mit dem GUCCI-Projekt haben wir die Möglichkeit, den direkten Kontakt zu den politisch Verantwortlichen zu suchen, die über Klima- und Gender-Strategien entscheiden. Früher haben wir an öffentlichen Anhörungen der Regierung teilgenommen, wenn es beispielsweise um ein Grünbuch oder den Entwurf für ein Energiegesetz ging, das verabschiedet werden sollte. Bei Klimafragen arbeiten wir hauptsächlich mit den Gemeinden und vor allem mit Frauen, denn bei der Gender-Thematik werden die Belange von Frauen gegenüber denen von Männern nach wie vor nur unzureichend berücksichtigt. Wir arbeiten mit den Frauen vor allem an den Themen Energie, Wasser und Ernährungssicherheit vor dem Hintergrund der Auswirkungen des Klimawandels. Wir verschaffen den Frauen Zugang zu Ressourcen, den richtigen Plattformen und einflussreichen Personen, damit sie sich Gehör verschaffen können, bei öffentlichen Anhörungen wahrgenommen werden und in der Lage sind, ihre eigene, spezielle Situation besser zu gestalten.
Was erhoffen Sie sich von der COP 23 für Ihre Arbeit?
Manchmal kann es frustrierend sein, wenn die Verhandlungen ohne konkretes Ergebnis enden. In Bezug auf meine Arbeit hier würde ich mir wünschen, dass Gender-Fragen und die vor Ort gesammelten Erfahrungen stärker berücksichtigt werden und dass man unser Wissen in diesem Bereich ernst nimmt. Wenn ich von den Verhandlungen nach Hause zurückkehre, organisieren wir in der Regel Veranstaltungen mit den verschiedenen Gruppen, vor allem mit den Frauengruppen an der Basis, die wir vertreten, und berichten über den Konferenzverlauf. Die Menschen wollen gerne etwas hören, das ihnen Kraft und Hoffnung gibt, beispielsweise, dass man ihre Situation vor Ort anerkennt, denn sie sind schließlich die ersten, die die Auswirkungen des Klimawandels zu spüren bekommen. Wenn wir dagegen über all die technischen Details berichten, die auf der COP so viel Zeit kosten, entmutigen wir die Menschen. Wir müssen also Feedback zu genau den Problemen geben, die die Menschen vor Ort betreffen. Ich hoffe, dass es im Zuge der Klimaverhandlungen irgendwann gelingt, die Sprache der Menschen an der Basis zu sprechen und ihnen Hoffnung auf einen Systemwandel zu machen, der ihnen zugutekommt.
Vielen Dank für das Interview!
Nähere Informationen über den Gender Action Plan erhalten Sie in der Aufnahme der Pressekonferenz mit Ndivile Mokoena auf der COP 23: https://unfccc.cloud.streamworld.de/webcast/putting-the-gender-action-plan-into-practice
Der Link wurde in die Zwischenablage kopiert
Kontakt
IKI Office
Zukunft – Umwelt – Gesellschaft (ZUG) gGmbH
Stresemannstraße 69-71
10963 Berlin