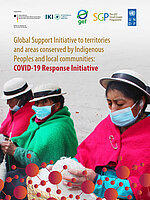Indigene Völker und lokale Gemeinschaften als Partner des Naturschutzes

Seit 2013 unterstützt die Internationale Klimaschutzinitiative (IKI) indigene Völker und lokale Gemeinschaften beim Management von Schutzgebieten.
Viele indigene Völker und lokale Gemeinschaften (Indigenous peoples and local communities, IPLCs) bewahren die Umwelt seit Jahrhunderten. Dies geht zurück auf ihre tiefen Beziehungen zu anderen Arten und einer spirituellen Verbundenheit zur Natur in der sie leben. IPLCs schützen und erhalten deshalb weltweit aktiv eine erstaunliche Vielfalt an Spezies, Lebensräumen und Ökosystemen. Ihr umfassender Beitrag zu einem gesunden Planeten bildet die Grundlage für sauberes Wasser und saubere Luft, gesunde Nahrungsmittel und Lebensgrundlagen für Menschen weit über die Grenzen ihrer Territorien hinaus. Gleichzeitig ist er von großer Bedeutung für das kulturelle, sprachliche, materielle und immaterielle Erbe der Welt.
Der Beitrag der IPLCs und die Methoden, mit denen sie ihre Gebiete schützen und bewirtschaften, werden von Fachleuten zunehmend anerkannt. Dies gilt auch für ihre Position als entscheidende Stakeholder im Management von Schutzgebieten. Diese so genannten ICCAs (Indigenous Peoples and Community-Conserved Territories and Areas) bedecken aktuell etwa 32 Prozent der globalen Landfläche und umfassen mindestens 36 Prozent der weltweit biologisch vielfältigsten Flächen.
Spektrum erweitern, Lebensgrundlagen verbessern
Die Internationale Klimaschutzinitiative (IKI) fördert diesen Ansatz seit 2013 mit dem Projekt „Unterstützung für indigene Völker und gemeinschaftlich erhaltene Gebiete und Territorien (ICCAs)“, auch bekannt unter dem englischen Titel „Global Support Initiative for territories and areas conserved by indigenous peoples and local communities (ICCA-GSI)“. Die Ziele des Vorhabens sind es, das Spektrum, die Diversität und die Qualität der Verwaltung von Schutzgebieten zu erweitern und die nachhaltige Lebensgrundlage indigener Völker und lokaler Gemeinschaften zu verbessern.
 Die Projektarbeit von ICCA-GSI umfasst drei Schwerpunkte, die auf verschiedenen Ebenen wirken: Auf lokaler Ebene steht die direkte Unterstützung von Maßnahmen zur Förderung einer guten ICCA-Verwaltung im Vordergrund, insbesondere zum Schutz des Ökosystems, der nachhaltigen Sicherung des Lebensunterhalts und zur Armutsbekämpfung. Auf nationaler Ebene setzt sich das Projekt mit rechtlicher und politischer Unterstützung für die Anerkennung und den Erhalt von ICCAs ein und bewertet die Verwaltung von Schutzgebieten. Regional und global liegt der Schwerpunkt auf der Vernetzung und der Förderung des Wissensaustauschs zwischen zivilgesellschaftlichen Initiativen verschiedener Länder. Die Aktivitäten von ICCA-GSI tragen gleichzeitig dazu bei, die Aichi-2020-Ziele des Übereinkommens über die biologische Vielfalt (CBD) auf nationaler und globaler Ebene zu erreichen – insbesondere die Ziele 11 (Ausdehnung der Schutzgebiete), 14 (Sicherung der wesentlichen Ökosystemleistungen) und 18 (Schutz des traditionellen Wissens). Außerdem leistet das Projekt einen Beitrag zum neuen globalen Rahmen für biologische Vielfalt nach 2020 sowie zur Plattform für lokale Gemeinschaften und indigene Völker der Klimarahmenkonvention der Vereinten Nationen.
Die Projektarbeit von ICCA-GSI umfasst drei Schwerpunkte, die auf verschiedenen Ebenen wirken: Auf lokaler Ebene steht die direkte Unterstützung von Maßnahmen zur Förderung einer guten ICCA-Verwaltung im Vordergrund, insbesondere zum Schutz des Ökosystems, der nachhaltigen Sicherung des Lebensunterhalts und zur Armutsbekämpfung. Auf nationaler Ebene setzt sich das Projekt mit rechtlicher und politischer Unterstützung für die Anerkennung und den Erhalt von ICCAs ein und bewertet die Verwaltung von Schutzgebieten. Regional und global liegt der Schwerpunkt auf der Vernetzung und der Förderung des Wissensaustauschs zwischen zivilgesellschaftlichen Initiativen verschiedener Länder. Die Aktivitäten von ICCA-GSI tragen gleichzeitig dazu bei, die Aichi-2020-Ziele des Übereinkommens über die biologische Vielfalt (CBD) auf nationaler und globaler Ebene zu erreichen – insbesondere die Ziele 11 (Ausdehnung der Schutzgebiete), 14 (Sicherung der wesentlichen Ökosystemleistungen) und 18 (Schutz des traditionellen Wissens). Außerdem leistet das Projekt einen Beitrag zum neuen globalen Rahmen für biologische Vielfalt nach 2020 sowie zur Plattform für lokale Gemeinschaften und indigene Völker der Klimarahmenkonvention der Vereinten Nationen.
Umgesetzt wird ICCA-GSI vom Entwicklungsprogramm der Vereinten Nationen (UNDP) als Teil des von der Globalen Umweltfazilität (GEF) durchgeführten Small Grants Programme (SGP). Die wichtigsten Partner sind das World Conservation Monitoring Centre des Umweltprogramms der Vereinten Nationen (UNEP WCMC), das Global Programme on Protected Areas der Weltnaturschutzunion (IUCN GPAP), das ICCA-Konsortium und das Sekretariat der Biodiversitätskonvention (CBD).
Neustrukturierung mit GPS in Belize
 Über einen wettbewerbsorientiertes Auswahlverfahren vergibt das SGP Förderungen für konkrete Maßnahmen auf lokaler Ebene und für partizipatorische Ansätze beim Kompetenzaufbau, um die Eigenverantwortung der Gemeinschaft und die Nachhaltigkeit der Auswirkungen zu gewährleisten. Mit Hilfe des IKI-Vorhabens wurde beispielsweise die Produktivität der Green Creek Farmers Cooperative im mittelamerikanischen Belize erhöht, die seit Anfang der 1980er Jahre rund tausend Hektar Urwald nachhaltig bewirtschaftet. Ein GPS-gestütztes Waldzonierungssystem ermöglichte eine Neustrukturierung der ICCA. Das Gebiet besteht jetzt aus drei Zonen: einer Schutzzone, einer Kakao-Agroforstwirtschaftszone und einer Zone zur landwirtschaftlichen Selbstversorgung der Bewohnerinnen und Bewohner. Die nachhaltige Bewirtschaftung sichert die dauerhafte Erhaltung der indigenen Areale, das Produktionsniveau der Agrar- und Nichtholzprodukten konnte erhöht werden. Der Ausbau der Straßeninfrastruktur auf einer Strecke von knapp 6,5 Kilometer erleichterte vor allem in der Regenzeit zudem die Arbeitswege und den Zugang der Kinder zu Bildung.
Über einen wettbewerbsorientiertes Auswahlverfahren vergibt das SGP Förderungen für konkrete Maßnahmen auf lokaler Ebene und für partizipatorische Ansätze beim Kompetenzaufbau, um die Eigenverantwortung der Gemeinschaft und die Nachhaltigkeit der Auswirkungen zu gewährleisten. Mit Hilfe des IKI-Vorhabens wurde beispielsweise die Produktivität der Green Creek Farmers Cooperative im mittelamerikanischen Belize erhöht, die seit Anfang der 1980er Jahre rund tausend Hektar Urwald nachhaltig bewirtschaftet. Ein GPS-gestütztes Waldzonierungssystem ermöglichte eine Neustrukturierung der ICCA. Das Gebiet besteht jetzt aus drei Zonen: einer Schutzzone, einer Kakao-Agroforstwirtschaftszone und einer Zone zur landwirtschaftlichen Selbstversorgung der Bewohnerinnen und Bewohner. Die nachhaltige Bewirtschaftung sichert die dauerhafte Erhaltung der indigenen Areale, das Produktionsniveau der Agrar- und Nichtholzprodukten konnte erhöht werden. Der Ausbau der Straßeninfrastruktur auf einer Strecke von knapp 6,5 Kilometer erleichterte vor allem in der Regenzeit zudem die Arbeitswege und den Zugang der Kinder zu Bildung.
Lösungen für Landnutzungskonflikte
Ein weiteres Beispiel ist die Unterstützung des Olengapa-ICCAs im Norden Tansanias. Das über 30.000 Hektar große Gebiet umfasst vier Dörfer und besteht überwiegend aus Weideland. Viehzucht ist die Haupteinnahmequelle der dort lebenden Massai-Hirten, die Akie sind hingegen Jäger und Sammler. Die beiden indigenen Gemeinschaften haben einzigartige traditionelle und kulturelle Werte für den Umweltschutz. Doch unter anderem Landnutzungskonflikte zwischen den Dörfern, externer Landraub und ein mangelndes Bewusstsein nachhaltiger Landnutzung beeinträchtigten zwischenzeitlich die Ökosysteme. Die Folgen: Abholzung, die Einfuhr nicht-heimischer Arten sowie nicht nachhaltige landwirtschaftliche Methoden.
Um die Situation zu verbessern, wurden Weideflächen und heilige Stätten innerhalb des ICCA identifiziert und in einem gemeinsamen Landnutzungsplan voneinander abgegrenzt. Als Teil dieses Plans gab es zudem Schulungen für die Gemeindemitglieder zum Umweltschutz und zu nachhaltigen landwirtschaftlichen Methoden. Die Maßnahmen zeigten Erfolg: Sie führten unter anderem zu mehr Biomasse in den geschützten Weidegebieten und damit zu gesünderem Vieh sowie zu einer größeren Vielfalt landwirtschaftlicher Nutzpflanzen und Heilkräuter. Partizipative Workshops stärkten zudem die Autonomie und die Umweltgerechtigkeit von Frauen und Jugendlichen.
Ein weiteres bemerkenswertes Ergebnis des Projekts: Die vier Dörfer sind nun formal anerkannt und haben einen offiziellen Besitztitel für ihr Land. Dies stärkte die Solidarität unter den Gemeinschaften beim gemeinsamen Schutz vor externen Übergriffen und Landraub.
Zusätzliche Mittel im Zuge der Corona-Pandemie
Indigene Völker und lokale Gemeinschaften zählen zu den am stärksten von Covid-19 bedrohten Bevölkerungsgruppen der Welt. Sie sind überdurchschnittlich schwer betroffen und haben oft keinen Zugang zu Gesundheitsversorgung, grundlegenden Dienstleistungen, sanitären Einrichtungen und anderen wichtigen Präventionsmaßnahmen.
Die IKI stockte die Mittel von ICCA-GSI deshalb im Rahmen des Corona-Response-Pakets um 15 Millionen Euro auf. Die zusätzlichen Gelder dienen dazu, die sozialen und wirtschaftlichen Auswirkungen der Pandemie abzumildern und künftige zu vermeiden. In der dadurch ermöglichten zweiten Phase des Projekts stehen acht unterschiedliche Themenbereiche im Zentrum der Maßnahmen, darunter Lebensmittelproduktionssysteme, die Prävention vor künftigen Pandemien und die Weitergabe indigenen und lokalen Wissen. So trägt die IKI auch in Zukunft dazu bei, dass IPLCs und ICCAs zu einem größeren Baustein zum Schutz unseres Planeten werden.
Dieser Beitrag ist Bestandteil des IKI-Jahresberichtes 2020 – Aktiv für den internationalen Klimaschutz. Weitere Informationen finden Sie auf der Sonderseite zum IKI-Jahresbericht 2020.
Der Link wurde in die Zwischenablage kopiert
Kontakt
IKI Office
Zukunft – Umwelt – Gesellschaft (ZUG) gGmbH
Stresemannstraße 69-71
10963 Berlin