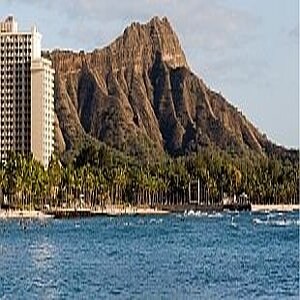Grüne Strassen in Nepal verhindern Katastrophen

Seit 2013 unterstützt ein IKI-Projekt in Nepal lokale Gemeinden bei der Katastrophenvorsorge.
Jedes Jahr fordern in Nepal Überschwemmungen, Erdrutsche und Erosion durchschnittlich 300 Menschenleben und verursachen Sachschäden von mehr als zehn Millionen US-Dollar. Das Land mit niedrigem Einkommensniveau ist besonders anfällig für die Auswirkungen von Naturkatastrophen.
Da die Gefahren insbesondere vor dem Hintergrund des Klimawandels zunehmen, ist es dringend erforderlich, einer proaktiven Risikominderung mehr Gewicht zu geben. Vor allem intakte Ökosysteme tragen entscheidend zur Stärkung der Resilienz von Gemeinden bei und bieten eine kostengünstige Möglichkeit, Gefahren durch Katastrophen zu mindern. Bei der Umsetzung von Risikominderungsmaßnahmen, die auf der Natur aufbauen, stellen sich jedoch eine Reihe von Fragen, wie: „Welche Maßnahmen müssen in einem bestimmten lokalen Umfeld realisiert werden?“; „Wie können die Gemeinden Forschungsergebnisse und internationale Programme für ihre Maßnahmen vor Ort nutzen?“ und „Wie lässt sich die Wirksamkeit der gewählten Vorgehensweise nachweisen?“.

Umsetzung von Lösungen auf der Grundlage wissenschaftlicher Erkenntnisse
In den nepalesischen Distrikten Parbat, Kaski und Syangja führen schlecht geplante und konstruierte Straßen wegen der Gefahr von Erdrutschen zu großen Risiken. Zur Bewältigung der Herausforderungen in der Region fördert das IKI-Projekt „Ecosystems - Protection for Infrastructure and Communities (EPIC)“ den gezielten Einsatz von Vegetation, um Hänge zu stabilisieren und die Gefahr von Erdrutschen zu mindern. Diese Technik wird auch als „Bioengineering“ bezeichnet.

Zur Weiterentwicklung dieser Vorgehensweise hat sich das Projekt bei der Auswahl der zur Stabilisierung einzusetzenden Pflanzen mit den lokalen Gemeinden abgestimmt und deren Kenntnisse der örtlichen Gegebenheiten berücksichtigt. In Kombination mit vor Ort durchgeführten Versuchen bietet dieses Wissen große Chancen. So wird nicht nur gewährleistet, dass sich die Pflanzen zur Stabilisierung von Hängen eignen, sondern auch, dass sie widrigen Klimaereignissen wie Dürren standhalten. Dadurch können die Hänge auch unter veränderten Klimabedingungen gesichert werden.

In der Zielregion wurden drei Demonstrationsstandorte für verschiedene gemeindebasierte Maßnahmen ausgewählt. Insbesondere wird getestet, wie wirkungsvoll Pflanzen Hänge an Straßen stabilisieren können und welche Pflanzen sich dazu am besten eignen. An den drei Standorten wurden mehr als 10.000 Pflanzen gesetzt, die nun von den Gemeinden im Hinblick auf ihre Eignung beobachtet werden. So wurde festgestellt, dass eine Reihe von Grasssorten zur Stabilisierung des Bodens beitragen und gleichzeitig als Einkommensquelle dienen, weil sie von den Gemeinden zur Herstellung von Besen verkauft werden können.
Darüber hinaus wurde auch eine ökonomische Bewertung vorgenommen, um den wirtschaftlichen Nutzen von durch Bioengineering gestalteten oder „ökologisch geschützten“ Straßen gegenüber ungeplanten oder „grauen“ Straßen zu vergleichen. Die Studie ergab, dass die Anfangskosten für den Bau einer „ökologisch geschützten“ Straße etwa 1,5 Mal so hoch sind wie für eine „graue“ Straße. Im Laufe der Zeit steigt jedoch der wirtschaftliche Nutzen der „grünen“ Straßen, weil herkömmliche Straßen höhere Instandhaltungskosten verursachen, die jedes Jahr wiederkehren.
Von der Theorie zur Praxis

Die Versuche an den Pilotstandorten lieferten wichtige Erkenntnisse und Lernerfahrungen, die genutzt werden sollen, um Bioengineering als wirkungsvolle Risikominderungsstrategie in politischen Entscheidungsprozessen zu verankern. Zur Förderung des institutionellen Wandels wurde im Oktober 2016 ein Workshop auf nationaler Ebene durchgeführt, an dem verschiedene Stakeholder aus den Bereichen Politik, Praxis und Wissenschaft teilnahmen. Die Ergebnisse des Workshops stellten Wissensaustausch, ein größeres Bewusstsein für den Nutzen von Ökosystemen in der Katastrophenvorsorge und eine bereichsübergreifende Zusammenarbeit als wichtigste Faktoren heraus, mit denen solche auf der Natur beruhenden Lösungen auf nationaler Ebene verbreitet werden sollten. Das Bundesministerium für Umwelt, Naturschutz, Bau und Reaktorsicherheit unterstützt das EPIC-Projekt im Rahmen seiner Internationalen Klimaschutzinitiative (IKI) mit 4 Mio. Euro. Durchgeführt wird das Projekt von der Internationalen Union zur Bewahrung der Natur und natürlicher Ressourcen (IUCN) in Kooperation mit der Universität von Lausanne.
Der Link wurde in die Zwischenablage kopiert
Kontakt
IKI Office
Zukunft – Umwelt – Gesellschaft (ZUG) gGmbH
Stresemannstraße 69-71
10963 Berlin